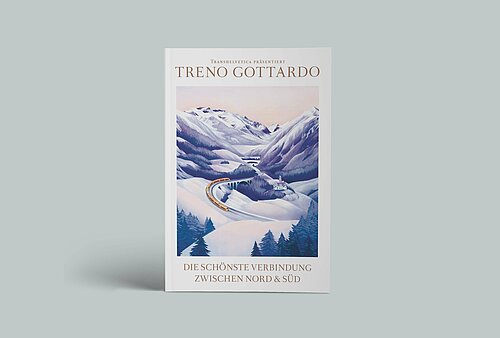Viganò begab sich deshalb auf Spurensuche, um zu verstehen, wie dieses für damalige Zeiten sehr moderne Bauwerk nach Locarno gekommen war. Einerseits wusste er, dass es vor 1532 gebaut worden sein musste. Denn im Vertrag, mit dem die Eidgenossen das Grundstück samt Wassergraben damals einem gewissen Battista Appiani verkauften, ist die Rede vom Raffelin – also dem Rivellino. Andererseits war undenkbar, dass es bereits in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstanden sein konnte, wie die Historiker bis dahin glaubten. Denn die ersten Bollwerke dieser Art gehen auf das Ende des 15. Jahrhunderts zurück, als Militärarchitekten in Mittelitalien ihre Bauten als Reaktion auf die gesteigerte Feuerkraft der Artillerie weiterentwickelten. Fünfeckige Bastionen lösten damals die gedrungenen runden Türme ab.
Nachdem Viganò die Entstehungsphase des Rivellino auf die Zeit zwischen 1490 und 1532 eingrenzen konnte, war es ein leichtes, den Bauherren zu identifizieren. In Frage kamen entweder die Franzosen, die das Herzogtum Mailand und damit Locarno von 1499 bis 1513 beherrschten, oder die Eidgenossen, denen das Schloss von 1513 bis 1532 gehörte. Doch Letztere waren eher für ihr destruktives denn für konstruktives Wirken bekannt. Da Locarno für sie keine strategische Bedeutung hatte, beschlossen sie 1532, weite Teile der Burg zu schleifen und das Abbruchmaterial – Steine, Holz, Eisen – anderweitig zu verwenden. Erhalten blieb einzig ein Turm mit einem Wohnpalast, der den eidgenössischen Vögten als Residenz diente.
Für Viganò war daher klar, wo er suchen musste: In den Archiven der Lombardei. Und tatsächlich: Er fand rasch Spuren, beispielsweise in Luino. Die Bewohner des Marktfleckens am Lago Maggiore beklagten sich, dass sie vom „Grametter vonn Mayland“ zu Zwangsarbeiten an der Burg von Locarno verpflichtet worden waren. Grametter? Damit war der „Grand Maître“ gemeint, der Statthalter des französischen Königs in Mailand, Charles II. d’Amboise. Dieser verwaltete Mailand von 1502 bis zu seinem Tod im Jahr 1511.
Auch in den Stadtchroniken von Lodi und Como konnte Viganò nachlesen, dass Charles d’Amboise überall im Herzogtum Mailand die Burgen stärker befestigen liess und dabei immer nach demselben Muster vorging: Er liess Häuser niederreissen und verpflichtete Leute aus der Gegend zu Zwangsarbeit und zur Lieferung von Baumaterialien. Durch das Abreissen der Häuser wurde jeweils der Platz vor den Burgen vergrössert, so dass die Verteidiger fortan freie Schussbahn hatten. Den Angreifern fehlte überdies eine mögliche Deckung für ihre Geschütze. Das Bollwerk von Locarno beispielsweise konnte einen Winkel von 270 Grad abdecken und somit das Castello Visconteo vom Haupttor bis zum unbefestigten Hafen schützen.
Diese Arbeiten wurden im Sommer 1507 in grosser Hektik durchgeführt. Denn die Franzosen fürchteten, Kaiser Maximilian plane mit Hilfe der Eidgenossen einen Einfall in der Lombardei. Locarno war der am stärksten exponierte Grenzposten des Herzogtums Mailand, nachdem Bellinzona mit seinen drei Burgen im Jahre 1503 kampflos an die Eidgenossen gefallen war. Deshalb erstaunt es nicht, dass Charles d’Amboise im Juli 1507 die Befestigungsanlagen im Tessin in Augenschein nahm. Man kann somit davon ausgehen, dass er den Bau des Rivellino anordnete. Doch wer war der Ingenieur, der in den südlichen Voralpen in einer Art baute, die sich damals erst in Mittelitalien standardisiert hatte? Die Vermutung, dass es sich um Leonardo da Vinci gehandelt haben könnte, ist nicht ganz neu. Schon 1894 hatte der Kunsthistoriker Johann Rudolf Rahn die Ähnlichkeit zwischen den Bollwerken des Castello Visconteo in Locarno und des Castello Sforzesco in Mailand festgestellt.